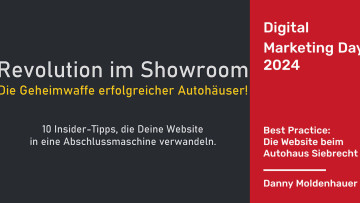Sie sind bis heute noch nicht ganz ausgestanden. Aber Schrempp bekräftigte in einem Interview: "Die Fusion ist schon längst erfolgreich umgesetzt." Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Konzern in einigen Jahren die Nummer 1 der internationalen Automobilhersteller ist. Das Interview finden Sie rechts in der Downloadbox. Champions League des Automobilbaus Ausgangspunkt des Megadeals waren auf Daimler-Seite Überlegungen, wonach das nötige Wachstum in einer globalisierten Industriewelt allein nicht zu schaffen sei und sogar die Gefahr einer Übernahme bestand. Die Stuttgarter Konzernstrategen gingen davon aus, dass ihre Industrie künftig von einer kleinen Superliga dominiert werden würde, zu der auf jeden Fall General Motors, Ford, Toyota gehören würden. Daimler-Benz und Chrysler sahen die Chance, in dieser Topliga mitzuspielen. Als "Fusion unter Gleichen" wurde das Ereignis von den beiden Konzernen bezeichnet. Dem ehemaligen Chrysler-Großaktionär Kirk Kerkorian, der damals die Fusion ausdrücklich begrüßt hatte, überkamen daran im November 2000 aber Zweifel. Resultat ist die noch heute anhängige Milliardenklage. Die zunächst vereinbarte Doppelspitze mit Schrempp und Eaton als Co-Chairman war eine rein diplomatische Lösung, die nicht funktionieren konnte. Eaton warf früher als geplant das Handtuch. Desillusionierte Aktionäre Die Märkte meinten bald, dass Chrysler seine beste Zeit offenbar hinter sich hatte: Nach unrealistischen Euphorie-Kursen von bis zu 100 Euro stürzte die DaimlerChrysler-Aktie Mitte 1999 unter 70 Euro ab - heute liegt sie um 30 Euro. Der Aktienwert ist seit der Fusion um über 50 Prozent gesunken. Zwar haben in den vergangenen fünf Jahren auch die Papiere von GM (minus 56 Prozent), Ford (minus 74 Prozent) oder VW (minus 46 Prozent) kräftig Federn lassen mussten (Stichtag 9. April). Doch dürfte dies die enttäuschten DC-Aktionäre kaum trösten. Ihnen brachte die Fusion bisher außer recht üppigen Dividenden kein Glück. Im Jahr 2000 verstärkten sich die Probleme auf dem US-Automarkt und für Chrysler. Dazu gehörten die teilweise veraltete Modellpalette und die viel zu hohen Produktionskosten. Im November 2000 zog Schrempp deshalb die Reißleine: Chrysler-Chef James Holden musste gehen, mit Dieter Zetsche und Wolfgang Bernhardt kam erstmals ein deutsches Führungsduo an die Spitze eines US-Autokonzerns. "Dieder" und "Wulfgäng" from Germany Der Ärger jenseits des Atlantiks über die "Invasoren" war zunächst gewaltig, zumal Zetsche eine unangenehme Botschaft im Gepäck hatte. 26.000 Jobs sollten gestrichen und sechs Fabriken geschlossen werden. Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelang 2002 aber deutlicher als erwartet, auch wenn die US-Autokonjunktur und die Rabattschlachten weiterhin eine große Herausforderung bedeuten. Heute gelten "Dieder" und "Wulfgäng" in Detroit nicht mehr als die bösen Deutschen, sondern eher als Retter von Chrysler. Schrempp gestand damals ein, dass die Fusion sich anders entwickelt hatte als geplant. An der für richtig erkannten Strategie hielt er aber eisern und trotz heftiger Kritik fest. Heute weiß man im Konzern, dass man am Anfang wohl auch zu euphorisch war. Dennoch zieht der deutsch-amerikanische Autokonzern im Mai 2003 ein positives Fazit: Nach Fahrzeugabsatz (inkl. Mitsubishi) sei man heute die Nummer 3 der Welt, beim Umsatz und dem Börsenwert sogar die Nummer 2. Und dank der Beteiligung bei Mitsubishi sei man der global am ausgewogensten aufgestellte Autohersteller. Beschäftigt werden heute im Konzern über 365.000 Mitarbeiter. (dpa/pg)
Thema: Happy Birthday, DaimlerChrysler?
Vor einem halben Jahrzehnt wirbelte eine "Eheschließung im Himmel" die Autowelt durcheinander / Schrempp-Interview zum Download