HB ohne Filter vom 17. Februar 2012
präsentiert von
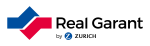
Heute mit den Themen: Unternehmerische Entscheidungskultur, Sichtbare Marktaktivitäten, Daimlers Sanierungs-Dezennium, Toyota – Rückkehr an die Spitze, Weiterverrechnung von Kleinteilen.
Steigen Sie ein in die Diskussion! Am Ende des Beitrags finden Sie den Button “Kommentare“. Klicken Sie darauf und kommentieren Sie Prof. Brachats Kommentar.
13. Februar - Montag
Unternehmerische Entscheidungskultur
Auf dem Partner-Event der Santander Consumer Bank trat als VIP-Referent der Schweizer Weltklasse-Schiedsrichter Urs Meier auf. Er arbeitete in seinem motivierenden Glanzauftritt die Parallelen zum Unternehmerdasein heraus. Die bessere Bezeichnung für den "Schiri" wäre "Spielleiter". Jeder Unternehmer hat jeden Tag "sein Spiel" zu leiten. Und das gelingt nur mit einer gehörigen Menge an Entscheidungen. Pro Bundesliga- oder Champions League-Spiel pfeift ein Schiedsrichter zwischen 120 und 150 Mal. Das sind die bewussten Entscheidungen. Es kommt dieselbe "Menge" an unsichtbaren Entscheidungen hinzu. 300 Entscheidungen pro Spiel! Unglaublich! Und das in einer "Netto-Spielzeit" von rund 53 Minuten von 90 Minuten.
Meier: "Du musst als Schiedsrichter schneller pfeifen, sonst pfeifen die Zuschauer." Und das bei einer durchschnittlichen "Herzfrequenz" von 158. Also, Entscheidungen bei hohem Puls! Und so wird es auch bei schwerwiegenden Entscheidungen im Unternehmen sein. Ob allerdings jeder Chef "pro Spiel", sprich Arbeitstag, zwölf Kilometer wie ein Schiedsrichter läuft, ist unwahrscheinlich. Meier macht ganz deutlich: Fair geht vor! Man muss also vom anderen her denken. Es geht um den Schutz der Spieler. Anständig muss es stets sein. Entscheiden heißt auch Risiken einzugehen. Da tut man sich – wie Meier – mit über 800 gepfiffenen Spielen und 23 Jahren Erfahrung leichter. Entscheiden bedeutet dann ein klares Ja oder ein klares Nein. Und das mit allen Konsequenzen. Das ist Verantwortung. Jeder Mensch macht Fehler. Auch Schiedsrichter. Wobei stets die Grundregel zu beachten ist: Der Schiedsrichter darf nur das pfeifen, was er selbst gesehen hat. Meier zeigte dazu heikle Szenen und Grenzsituationen auf und machte dabei die Händler zum praktischen Schiedsrichter. Da gab es "gespaltene Pfiffe". Wie das so ist mit Fehlentscheidungen und deren psychischen Folgen. Meier garnierte weitere Situationskomik mit wunderbarem Humor.
Fazit: Man muss Menschen mögen, beziehungsfähig und berechenbar sein. Entscheidend ist die Tat. Meier: "Bei manchem muss man da mal wieder die Duracell reinschieben, dass er wach wird. Die Bundesliga ist die drittbeste Liga der Welt. Da marschieren wir nicht auf das Matterhorn, sondern auf den Mount Everest (8.848 Meter). Und wer dazu nicht die Kondition hat, sollte sich besser nicht auf dieser Ebene bewegen." Der Vorname Urs trifft man vorwiegend nur in der Schweiz an. Ursus, aus dem Lateinischen, bedeutet „Bär“. Urs ist der Bärenstarke. Die weibliche Form ist die deutsche „Ursula“, die "niedliche Bärin"! Urs Meier legte eine leibhaftige, faszinierende Bilderbuchpräsentation über das beeindruckende Phänomen eines Weltklasse-"Schiris" vor. Er bekam großen Applaus. Welcher Schiedsrichter erhält schon Applaus? Die Automobilhändler machen das möglich!
Urs Meier, der Schweizer Weltklasseschiedsrichter im Gespräch mit AUTOHAUS-Herausgeber Prof. Hannes Brachat (Bild zum Vergrößern anklicken)
14. Februar – Dienstag
Daimlers Sanierungs-Dezennium
2011 wird für die Daimler AG als das erfolgreichste Geschäftsjahr in der eigenen Geschichte ausgerufen. 2009 wurde noch ein Verlust von über 2,1 Milliarden Euro eingefahren. Man machte sich damals schon ernsthaft Sorgen, ob Daimler in Berlin anklopfen müsse, um sich im Januar 2011 überhaupt eine Jubiläumsfeier zu 125 Jahre Automobil leisten zu können. Dank China und der dort üppig verkauften S-Klasse bis hin zu den inzwischen eingezogenen Modellerneuerungen hat sich die Lage bei Daimler durchaus gebessert. Dennoch, Daimler galt stets als bestes Automobilunternehmen, mit dem höchsten Markenwert und der höchsten Profitabilität der Welt. Es war einmal. Die strukturellen Defizite sind einfach markant. Im Volumenausstoß hat BMW Daimler bereits 2004 überrundet. Audi vermutlich in 2011. Die Daimler-Gesamtstrategie für 2020 sucht man. Bis dahin wollen die Stuttgarter aber wieder im Premiumsegment ganz vorne auf der Bühne stehen.
Wie viele Motivationsschübe wurden von Konzernchef Dieter Zetsche (58) seit seinem Amtsantritt als Konzernchef 2006 gezündet? Er kam auf den Daimler-Thron, weil er Chrysler so vorbildlich saniert hat. Er war zu Beginn seiner Amtszeit ja nur damit beschäftigt, wie man "diesen Laden" Chrysler endlich los wird. 2007 war es soweit. Wegen der gesamten Verluste dieser "Ehe im Himmel", die sein Vorgänger Schrempp 1998 geschlossen hat, leidet der Konzern heute noch. Welt AG & Co. Dann die ewigen Korruptionsvorwürfe, die 2004 die US-Behörden auf den Plan riefen und intern zu einem Compliance-Trauma führten. Daimler hat außerdem im Vergleich zu anderen Konzernen ein grundsätzliches Kostenproblem. Man beachte einmal die Kosten pro Mitarbeiter pro Auto, den Umsatz pro Mitarbeiter, dann fällt Daimler durch jegliches Raster. Und schon sind wieder betriebsbedingte Kündigungen in einem Vertrag mit dem Betriebsrat bis 2016 ausgeschlossen. Genau so lange dauert voraussichtlich das Beschäftigungsverhältnis des Konzernchefs. Es mag vermessen klingen: Was Dieter Zetsche bis heute nicht geschafft hat, wird er auch bis 2016 nicht schaffen, geschweige bis 2020.
Die eigentliche Malaise liegt in der Grundstruktur der Niederlassungen. 95 Prozent der Niederlassungen weisen Jahr für Jahr "rote Zahlen" aus – was immer auch die wahren Gründe sind. Es stimmt aber umgekehrt auch, dass mal wieder den Kleinsten die Hunde beißen, nämlich den einzelnen Verkäufer. Er hat zusammen mit dem Serviceberater die wichtigste Funktion in einem Autohaus, nämlich aktiv zu verkaufen. Mit der getroffenen 50-Prozent-Regelung kommt etwas klar zum Ausdruck: Mangelnde Wertschätzung! So wird das aber nichts mit dem dringlich notwendigen Motivationsschub. Dieter Zetsche hat gerade in diesem Punkt seine Mitarbeiter inzwischen zu oft enttäuscht. "Das Beste oder nichts" sieht zumindest anders aus, als es nun die Mitarbeiter der MB-Niederlassung trifft.
15. Februar – Mittwoch
Toyota – Rückkehr an die Spitze
Der 11. Februar 2011, das Erdbeben in Japan, Fukushima und die Flutkatastrophe im Herbst in Thailand haben Toyota zugesetzt. Dennoch erwartet der Autobauer zum Geschäftsjahresende am 31. März 2012 einen Gewinn von zwei Milliarden Euro. Dahinter steht eine Rendite von maximal zwei Prozent. 2008 lag der Rekordgewinn bei 22,7 Milliarden Euro. Die Gewinnvorzeichen sollten sich in den Folgejahren ändern. Auf Toyota kamen in 2010 15 Millionen Rückruf-Autos zu. Ein Industrierekord! Seither werden Entscheidungs- und Kostenstruktur verschlankt. Man setzt abermals auf bessere Autos. Toyota will aufgrund des starken Yen verstärkt im Ausland produzieren. 2008 löste Toyota GM als größten Automobilhersteller der Welt ab. Auch 2010. 2012 soll nun die Rückkehr an die Spitze gelingen. Toyota will dann 9,58 Millionen Autos bauen.
17. Februar - Freitag
Weiterverrechnung von Kleinteilen
Sie erinnern sich. Früher haben wir bei jeder Rechnung pauschal zwei Prozent vom Teilegesamtbetrag einer Rechnung dem Kunden weiterverrechnet. Aufgrund der ADAC-Dauerintervention hat sich die Branche davon längst verabschiedet. Vielfach wird heute auf die Weiterverrechnung von Kleinteilen – auch Verbrauchsmaterialien genannt – verzichtet. Die Berner-Gruppe aus Künzelsau spricht hier vom C-Teile-Management und hat dazu ein ganzheitliches Kleinteilesystem auf den Perspektiven 2012 präsentiert. Zunächst wird für jedes Autohaus von einem der 650 Außendienstmitarbeiter ein persönliches Anforderungsprofil erstellt. Es geht also um die Planung, Bestückung, Beschriftung sowie das regelmäßige Auffüllen und Optimieren des Kleinteilelagers. Für die Regallösung gibt es sowohl eine Kauf- wie eine Mietlösung.
Das Berner C-Teile-Weiterverrechnungsmodell funktioniert so: Die Kleinteile werden in die Gruppen Schrauben, Sicherungs-/Verbindungselemente, Chemie, Kabel/Leitungen und Kfz-Kleinteile untergliedert. Der jeweilige Produktbereich ist farbig gekennzeichnet. Jetzt wird für den Einkaufspreis pro Gruppe der Einzelpreis ermittelt und mit einem Faktor ausgestattet, um auf den Verkaufspreis (ohne Mehrwertsteuer) zu gelangen. Eine Schraube mit Mutter – Rubrik blau – hat beispielsweise den Einkaufspreis von 0,13 Euro pro Stück. Sie erhält den Faktor acht und kostet damit 1,04 Euro pro Stück. Durch die Farbe und die individuelle Buchstabenzuordnung ist später automatisch auf der Kundenrechnung die Weiterberechnung möglich. Autohäuser, die die Kleinmaterialien konsequent weiterverrechnen, erreichen bereits zwischen 35 und 40 Prozent die Gewinnzone. Oder anders. Ein Autohaus, das pro Jahr für 10.000 Euro Kleinteile einkauft, kann mit einem Ertrag von 40.000 rechnen. Das schwäbische Motto "Kleinvieh macht auch Mist!" kommt hier zum Tragen. Detailinformationen können Sie erhalten über peter.siegert@berner.de, Tel. 07940121480.
Peter Siegert (l.), Geschäftsbereichsleiter Key Account Management, und Joachim Schönerr, Key Account Manager Kfz-Handwerk, am Berner-Stand auf den Perspektiven 2012
Spruch der Woche:
"Zusammen leben und arbeiten heißt, alle Tage miteinander neu beginnen."
Mit meinen besten Grüßen und Wünschen
Ihr
Prof. Hannes Brachat
Herausgeber AUTOHAUS



TN
Analytiker
TN
Michael Kühn
Karl Schuler
Analytiker
Analytiker
Michael Kühn
Analytiker
Michael Kühn
MB-Autoverkäufer
Michael Kühn
Analytiker
Insider
MB-Autoverkäufer
Sven Schuster
Analytiker
Analytiker