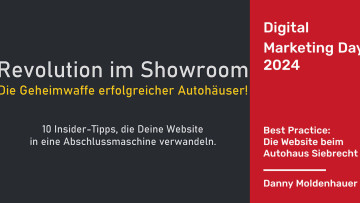Vieles, was heute selbstverständlich zur Schadenwelt gehört, wurde erst vor wenigen Jahren eingeführt. Der Fortschritt der Technik wird auch künftig für stetigen Wandel – und Rechtsstreite – sorgen.
Nicht nur die Fahrzeugtechnik hat in den vergangenen Dekaden eine rasante Weiterentwicklung vollzogen. Die fortschreitende Digitalisierung sowie neue gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen haben die Geschäftsmodelle der an der Unfallschadenabwicklung beteiligten Parteien mehr als einmal durcheinander gewirbelt. Dem musste sich selbstverständlich auch das Verkehrsrecht anpassen, um Lösungen für Streitfälle zu finden, die wenige Jahre zuvor noch gar nicht vorgesehen waren.
Rechtsanwalt Bernd Höke von der Kanzlei Voigt, dem heute größten Automotive-Spezialisten Deutschlands, blickt auf eine bewegte Zeit zurück und sieht auch in den kommenden Herausforderungen genug Stoff für seine Zunft und die Gerichtsbarkeit.
Verschiedenste Einflussfaktoren
AH: Herr Höke, seit inzwischen rund 30 Jahren befassen Sie sich berufsmäßig mit Haftungsfragen, zunächst von Seiten der Versicherungswirtschaft und seit einiger Zeit als Kanzleiinhaber. Welche Meilensteine des Verkehrsrechts haben Sie in diesen drei Dekaden erlebt?
B. Höke: Das waren in der Tat einige. Grundsätzlich ist festzustellen, dass Gerichte und Rechtsanwälte auf Entwicklungen in unterschiedlichsten Bereichen wie Gesellschaft, Wirtschaft und Technik reagieren müssen. Eine Herausforderung war zum Beispiel die Wiedervereinigung, als zum einen durch den Umstieg von Trabant auf Golf GTI eine massive Steigerung der Unfall- und Verletztenzahlen ausgelöst wurde. Die Öffnung gen Osten hat zudem zu einer drastischen Zunahme der Autodiebstähle geführt, worauf der Gesetzgeber mit der Pflicht zur Wegfahrsperre reagiert hat. Aber auch branchenintern
gab es natürlich eine Vielzahl von Veränderungen, die unmittelbare Auswirkungen
auf das Verkehrsrecht hatten.
AH: Welche Zäsuren gab es und wodurch wurden sie ausgelöst?
B. Höke: Eine Thematik, die sehr weit zurückreicht, sind Streitigkeiten in Bezug auf Mietwägen. Seit 1992 die geltende Vereinbarung des HUK-Verbandes, des Vorläufers des heutigen GDV, aufgekündigt wurde, gab es viel Zwist zwischen der Versicherungswirtschaft und den Mietwagenverbänden. Mit der Einführung der ersten Fraunhofer-Tabelle 2008 als Alternative zu Schwacke ergab sich eine zwiespältige Rechtsprechung, welche Zahlen den tatsächlichen Marktwert am besten abbilden. Der scherzhaft als "Fracke" bezeichnete Mittelweg, den viele Gerichte in der Folge einschlugen, hat gezeigt, dass solche Dilemmata durchaus bereinigt werden können. Ein ähnlicher Dauerbrenner ist natürlich das Schadenmanagement der Versicherungen, das seinen Ursprung in der Deregulierung des deutschen Versicherungsmarktes aufgrund europäischer Gesetzgebung hatte.
Vom Service-Plus zum Kosten-Minus
AH: Was hat sich damals verändert?
B. Höke: Bis Mitte der 1990er Jahre gab es relativ wenig Wettbewerb, vieles war tariflich eindeutig geregelt und die Gesellschaften konnten gutes Geld verdienen. Dies hat sich dramatisch geändert, es gab neue Tarife, einen phasenweise gnadenlosen und ruinösen Preiskampf und eine unglaubliche Vielfalt an Versicherungsbedingungen. Kein Wunder, dass damals auch auf Seiten der Anwälte Hochbetrieb herrschte. Man kann diese Phase, in der erste Werkstattnetze gegründet wurden, die es vorher in Deutschland ebenfalls nicht gab, durchaus als Paradigmenwechsel sehen: Vom rein reaktiven Verhalten einer Assekuranz, die bestenfalls telefonisch erreichbar war, hin zu einem proaktiven, kundenorientierten Servicegedanken. Man musste Auskunft geben können, was gravierende Umwälzungen in allen Schadenbereichen nach sich zog. Eine äußerst positive Entwicklung dieser Anfangszeiten war das Rehamanagement für Schwerverletzte, eine direkte Reaktion auf dieses Umdenken hin zu einer optimalen Begleitung und Wiedereingliederung nach einem Großschaden. Erst mit der Zeit verschob sich der Fokus dessen, was wir heute Schadenmanagement nennen, vom verbesserten Service für den Versicherungsnehmer hin zur Kosteneinsparung.
AH: Der Grundgedanke der Schadensteuerung war also ein positiver Ansatz?
B. Höke: Aus meiner Sicht ja, die Ablehnung, die er durch einige Branchenvertreter erfuhr, war wohl eher eine reflexhafte Reaktion auf Veränderung. Wobei man natürlich konstatieren muss, dass durch die zweite Welle des Preiskampfes nach der Jahrtausendwende eine negative Entwicklung eingesetzt hat, bei der auch Grenzen überschritten wurden. Ein Tabu hatte den Markt jahrelang geeint, nämlich Streitigkeiten nicht auf dem Rücken des Geschädigten auszutragen. Diese Ethik ist inzwischen teils verloren gegangen. Es wird gezielt um Beträge gekürzt, die den Gerichtsweg nicht lohnen. Aktuell besinnt man sich, wenn auch erneut aus wirtschaftlichen Zwängen heraus, wieder auf den Kunden und versucht, mit dem technologischen Fortschritt durch verbesserte Services Schritt zu halten. Die Transparenz und Konkurrenz, die Intermediäre wie Check24 geschaffen haben, die mittlerweile selbst als Versicherungsmakler auftreten und seit neuestem ihre Provision offen legen müssen, hat hier als Katalysator gewirkt.
Serienreife wieder ernst nehmen
AH: Der von Ihnen angesprochene Fortschritt macht auch vor der Fahrzeugtechnik nicht halt. Welche rechtlichen Schwierigkeiten sehen Sie durch autonomes Fahren auf uns zukommen?
B. Höke: Diese Thematik kann massive Auswirkungen in verschiedenste Richtungen haben. Vordergründig geht es um den – erneut positiven – Grundgedanken der Reduzierung der Unfallschwere und Verkehrstotenzahlen. Ich persönlich sehe den treibenden Faktor eher im Zugriff auf Kundendaten und die Ausweitung des Lebensraumes auf das Auto, wie Google das formuliert hat. Wer nicht selbst fahren muss, kann schon auf dem Weg ins Büro produktiv sein oder aber Werbung empfangen und konsumieren.
Was im Bereich Transport und Logistik durchaus seine Berechtigung hat, weil es Kosten reduziert und die Bestellungen über das Internet weiter zunehmen werden, sehe ich im privaten Sektor zwiespältig. Wo ist der Nutzen für Normalsterbliche? Rein rechtlich gesehen wird sich der Schwerpunkt von unserer heutigen Kfz-Haftpflicht in Richtung Produkthaftung verschieben, die komplett umgebaut werden muss, da sie für den Massenverkehr nicht konzipiert wurde.
AH: Die Einführung der Technik wird sich dennoch nicht aufhalten lassen. Sie sehen also keine positiven Auswirkungen auf die Unfallzahlen voraus?
B. Höke: Natürlich wird das autonome Fahren kommen, weil es technisch möglich ist. Bis es sich komplett durchgesetzt hat, werden aber noch einige Jahre des Mischverkehrs vergehen – rein rechnerisch bedingt bei weniger als zwei Millionen Neuzulassungen pro Jahr und rund 45 Millionen Fahrzeugbestand. Das Beispiel Tesla hat unlängst gezeigt, wie anfällig die Technik noch ist und wie unsagbar komplex die Vielzahl von Situationen, die rein rechnerisch abgebildet werden muss und mit geeigneter Infrastruktur zu hinterlegen ist. Und das sowohl herstellerübergreifend als auch grenzüberschreitend. Hier ist noch einiges an Standardisierungsaufwand zu betreiben. Schon aktuell sehen wir ja eine Zunahme der Unfallzahlen, die meiner Meinung nach auch auf eine Mischung aus falschem Sicherheitsempfinden und Überforderung des Fahrers zurückzuführen ist.
Navigationssystem, Headup-Display, das Auto liest SMS vor – reicht die Konzentration für den Verkehr bei der Vielzahl an Informationen überhaupt noch aus? Bedenklich stimmt mich auch die Zunahme der Fälle im Bereich Sachmängelhaftung. Bei allem technischen Fortschritt sollte man die Wünsche des Kunden nicht aus den Augen verlieren. Die Reduktion der Testzeiträume durch immer kürzere Entwicklungszyklen darf nicht dazu führen, dass Autos zu Bananenprodukten werden, die erst beim Kunden reifen. Schon gar nicht, wenn diese automatisiert unterwegs sein sollen.
AH: Herr Höke, vielen Dank für dieses Gespräch.
Bundesweit aufgestellte Verkehrsrechts-Kanzlei
Die Kanzlei Voigt ist heute an insgesamt 27 Standorten in Deutschland vertreten. Neben dem Gründungs-Standort München und der Zentrale in Dortmund wurden in den vergangenen Jahren Kanzleien in folgenden Orten eröffnet: Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Dresden, Erfurt, Essen, Freiburg im Breisgau, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Kassel, Kempten (Allgäu), Köln, Landshut, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Mannheim, Münster, Neubrandenburg, Rostock, Saarbrücken und Stuttgart. (kt/wkp)