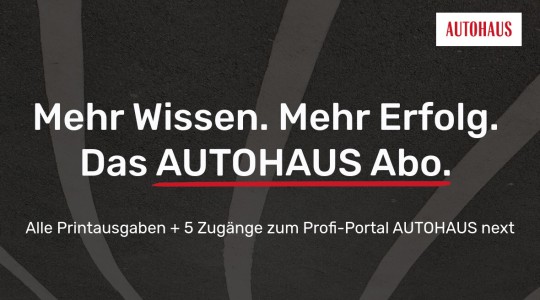Ob eine Kaufprämie für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) sinnvoll ist oder den Markt eher verzerrt, hängt entscheidend von ihrer Ausgestaltung ab. Pauschale Förderungen, wie sie in der Vergangenheit teils praktiziert wurden, haben zwar kurzfristig den Absatz gesteigert, aber keine nachhaltigen Strukturveränderungen bewirkt.
Die nun von der Bundesregierung beschlossene Neuausrichtung der E-Auto-Förderung ab 2026 geht daher in eine richtige Richtung. Durch eine sozial gestaffelte Förderung nach dem Vorbild des französischen "Social Leasing" sollen vor allem Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen beim Umstieg unterstützt werden. Dadurch wird der Zugang zur Elektromobilität breiter, ohne den Markt durch hohe Einmalprämien künstlich zu verzerren.
Ein Blick nach Frankreich zeigt, dass das dortige Sozial-Leasing-Programm seit 2024 als erfolgreiches Modell gilt. Es ermöglicht einkommensschwächeren Haushalten das Leasing eines Elektroautos für unter 100 Euro im Monat, oft inklusive Versicherung und Wartung. Das Programm gilt als "smarter E-Auto-Trick", weil es nicht nur den Absatz steigert, sondern auch soziale Teilhabe und Klimaschutz fördert.
Leasing als Nachfrageimpuls
Leasingmodelle wirken generell nachfragefördernd, weil sie finanzielle und psychologische Hürden beim Umstieg senken. Anstatt den vollen Kaufpreis zu investieren, zahlen Kundinnen und Kunden nur eine monatliche Rate – das reduziert das Risiko und schafft Planungssicherheit. Gerade in einem sich technologisch schnell entwickelnden Markt vermeiden Verbraucher so hohe Kapitalbindungen und Unsicherheiten über den zukünftigen Restwert. Kurze Vertragslaufzeiten ermöglichen zudem einen unkomplizierten Wechsel auf neue Modellgenerationen.
Für den Markt bedeutet dies: Leasing sorgt für stabile Nachfrage, stärkt den Absatz kleiner und kompakter Elektroautos und führt nach Vertragsende zu einem wachsenden Angebot an gepflegten Gebrauchtfahrzeugen. Dadurch wird Elektromobilität breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich, während sinkende Gebrauchtwagenpreise den Einstieg zusätzlich erleichtern.
Herausforderungen bestehen in der begrenzten Fahrzeugauswahl (meist Modelle unter 20.000 Euro), regional ungleicher Ladeinfrastruktur und den hohen staatlichen Kosten. Zudem sind kurze Leasinglaufzeiten ökologisch ambivalent, da sie häufigere Fahrzeugwechsel begünstigen und den Ressourcenverbrauch erhöhen können.
Wie erfolgreich ein Social-Leasing-Modell in Deutschland wird, hängt entscheidend von seiner konkreten Ausgestaltung ab:
- Einkommensgrenzen müssen sozial gerecht und administrativ praktikabel sein
- Fahrzeugauswahl sollte ausreichend breit sein, um Stadt- und Landbewohner gleichermaßen zu erreichen
- Deutlich reduzierte Leasingraten, ähnlich dem französischen Modell, sind notwendig, damit das Programm eine echte Nachfragewirkung entfaltet
Auch in Deutschland soll die Förderung nicht isoliert, sondern als Teil einer umfassenden Strukturpolitik gestaltet werden. So werden die Kfz-Steuerbefreiung bis 2035 verlängert, steuerliche Vorteile für elektrische Dienstwagen eingeführt und der Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleunigt. Ladepunkte sollen schneller genehmigt und errichtet werden, während Preistransparenz per App die Nutzerfreundlichkeit erhöhen soll. Nur mit einer flächendeckenden, bezahlbaren Ladeinfrastruktur kann die Förderung ihre volle Wirkung entfalten.
Industriepolitisch verfolgt die Bundesregierung zudem das Ziel, die europäische Produktion von Batterien und Fahrzeugen zu stärken und so die Wertschöpfungskette im Inland zu sichern. Vor dem Hintergrund von Absatzflaute und Arbeitsplatzabbau soll die Förderung nicht nur den Absatz, sondern auch Investitionen und Beschäftigung stabilisieren.
Richtig umgesetzt kann eine solche gezielte Förderung ökologische, soziale und industriepolitische Ziele miteinander verbinden – sie beschleunigt die Dekarbonisierung, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie und erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung. Eine pauschale Kaufprämie ohne soziale Staffelung oder strategische Einbettung wäre dagegen wenig sinnvoll, da sie kurzfristige Nachfrageeffekte erzeugt, aber langfristig weder Klimaziele noch Marktstabilität fördert. Die geplante Neuausrichtung – unter Einbezug von Elementen des Sozialleasings – ist daher als pragmatischer, sozial gerechter und wirtschaftlich tragfähiger Übergang zur Elektromobilität zu bewerten.